Dass die Töne der „wohltemperierten“ Tonleiter nicht mehr Grundlage des Komponierens sind, hatte ich schon vorgestern nach dem ersten Konzert des Berliner Festivals Ultraschall hervorgehoben. Töne, die uns so vertraut sind, dass wir sie beim Namen rufen: c, d, e, f, g und so weiter, dazwischen cis, es und fis, oder italienisch: do, re, mi, fa, so... Weil wir die schmetternden Arien der Callas oder von Domingo im Ohr haben, kennen wir auch die italienischen Namen. Aber was sie bezeichnen, verschwindet mehr und mehr. Vorgestern war es nur ein Einzelfall, die Komposition Recherche sur le fond für Orchester von Charlotte Seither, an dem ich das feststellte. Zu referieren war, wie sie ihr Abweichen von jenen Tönen, die sozusagen „normal“ gewesen waren, noch als einen revolutionären Akt verstanden hatte – noch immer, besser gesagt, denn natürlich ist ihr bewusst, dass andere vorausgegangen sind, Scelsi, Sciarrino, Lachenmann -: „Zerstören, um zu erkennen.“
Aber ihr Stück ist 2010/11 entstanden. Gestern standen Stücke von 2015 und 2018 auf dem Programm. Das Gefühl, einer Revolution beizuwohnen, hat man nicht mehr. Junge Leute wie der 34jährige Christian Mason, dessen Komposition Zwischen den Sternen für Ensemble (2018) uraufgeführt wurde, bewegen sich ganz selbstverständlich in einer neuen Epoche, wo sie nur jeweils den eigenen Akzent setzen. Es geht auch nicht mehr speziell um den Ton, als ob man ihn isolieren könnte; diese Betrachtungsweise ist selbst noch den Hörgewohnheiten der älteren Epoche verhaftet. Die wohltemperierte Skala besteht ja wirklich aus Einzeltönen. Man hat das nie bemerkenswert finden müssen, weil doch zusammenhängende Bilder, Bewegungen, ja Landschaften beim Komponieren herauskamen. Bei Verdi gibt es Melodien, in denen die Einzeltöne scharf geschieden sind und wie Steinchen einander hinterhergeworfen werden, aber wo denn sonst? Trotzdem gab es keine Komposition, die nicht aus einer sehr kleinen Menge einzelner Bausteine zusammengesetzt war.
Was sich demgegenüber verändert hat, wurde gestern sehr deutlich, weil zwischen neuesten Kompositionen auch eine von Iannis Xenakis, der zu den Nachkriegs-Avantgardisten gehört hatte, auf dem Programm stand. Dem Serialismus à la Boulez oder Stockhausen ist er zwar nicht zuzurechnen, doch hat er mit diesem das mathematisch-konstruktive Herangehen geteilt. Adornos Beobachtung, dass Zuhörer seriell komponierter Musik, statt noch einer Entwicklung beizuwohnen, es eher mit der Aufzeichnung einer Architektonik, eines klingenden Hauses zu tun bekommen, über die man mit Ohren gleitet wie sonst mit Augen über ein Gemälde, muss einem bei Xenakis schon deshalb einfallen, weil er zwölf Jahre Assistent des Architekten Le Corbusier war und auch selbst Häuser entworfen hat. Einen Pavillon der Brüsseler Weltausstellung (1958) entwarf er nach denselben hyperbolischen Kurven, die schon seine kurz zuvor entstandene Komposition Métastasis (1953/54) strukturiert hatte.
Ich referiere das, um an eine Gewohnheit zu erinnern: Wir sehen den großen kompositorischen Einschnitt in der Entwicklung der neuzeitlich-europäischen Musik im Übergang vom „tonalen“ zum „atonalen“ Komponieren und denken dabei an die Neuheiten zunächst der Zweiten Wiener Schule (Schönberg, Berg, Webern) und dann eben der Avantgarden nach 1945. Danach sehen wir noch, wie die konstruktive Strenge gelockert wurde, es gab Rückkehr zur „Subjektivität“, damit zum Älteren und das scheint schon fast alles gewesen zu sein. Diese Wahrnehmung eines Einschnitts ist vollkommen berechtigt. Doch nun gibt es einen weiteren Einchnitt. Lange hat er sich angebahnt, neben Scelsi oder Lachenmann haben auch Cage und die Elektroakustik mitgewirkt, in seiner Grundsätzlichkeit fängt er jetzt erst an, überblickt werden zu können.
Im gestrigen Konzert trat er eben deshalb so deutlich hervor, weil man Mason und die anderen Neuen mit Xenakis vergleichen konnte. Dessen Komposition Plektró für sechs Instrumente (1993) war ein Muster von „Atonalität“, auch in seiner Komplexität und „Dissonanz“ und auch darin, dass eine Würdigung Schönbergs in ihm steckte. Die Besetzung ist nämlich dieselbe wie in Schönbergs Melodram Pierrot Lunaire (1912), mit dem Unterschied nur, dass die menschliche Stimme durch Schlagzeug ersetzt ist. Aber dieses Werk klang neben den anderen, die vorher und nachher zu hören waren, wie eine Botschaft aus längstvergangenen Zeiten. Eben weil es das einzige war, das aus wohltemperierten Tönen bestand. Als schon Schönberg den Unterschied von Konsonanz und Dissonanz bestritten hatte, konnte man seiner Begründung intellektuell zwar folgen, das Gehör hielt aber noch an ihm fest. Das ist jetzt vorbei. Man hört inzwischen Xenakis wie Brahms, schreibt Plektró Eigenschaften wie Zartheit und lyrische Schönheit zu, unterbrochen von der heftigen Leidenschaft des Schlagzeugs, zu dem immer auch das Piano gehört.
Was ist demgegenüber das Neue? Heute werden Geräuschwelten ausgelotet. Zu den Geräuschen können Klänge gehören, die einer Konstellation wohltemperierter Töne sehr nahe kommen. Und auch dagegen, solche einmal direkt vorkommen zu lassen, spricht natürlich nichts. Mit großer Selbstverständlichkeit dominiert aber das Geräuschhafte, das früher in den Konzertsälen keinen Platz hatte. Wiederum, es sind ausgewählte, erdachte, insofern künstliche Geräusche, dabei immer noch erzeugt von den Instrumenten des traditionellen Orchesters. Und immer noch ist Schönheit das Auswahlprinzip. Eine neue Schönheit freilich, die zu beschreiben man erst noch lernen muss. Gleiten die schönen Geräusche zwar leicht ineinander über, wird ebenso ihre Verschiedenheit betont – eine Verschiedenheit auf winzigsten Strecken, Feldern, Anhöhen, dennoch immer markant - und kommt es zur Polyphonie, das heißt hörbaren Übereinanderschichtung. Diesen Kompositionen hört man viel Ordnung an, worin sie aber besteht, erschließt sich nicht unmittelbar. Bei Schönberg gibt es Überlegungen, nach welchen Prinzipien zwei „atonale“ Akkorde ineinander übergehen. Bestimmt könnte man auch Prinzipien des Übergangs zweier Geräuschkomplexe ineinander angeben.
Um zu sagen, was bei all dem herauskommt, bietet sich dieselbe Metapher „Landschaft“ an, mit der auch etwa die Sätze der Sechsten von Beethoven, der „Pastorale“ beschrieben werden können. Sie heißen dort ja auch so, „Szene am Bach“, „Lustiges Zusammensein der Landleute“ und so weiter. Obwohl aber diese Beethovenschen Landschaften dem Ohr, weil es so erzogen ist, immer noch vertrauter sind, zeigt sich doch im Vergleich, dass ihre Künstlichkeit diejenige der Landschaften eines Christian Mason weit übertrifft. Denn dessen Geräusche stehen den Alltagsgeräuschen näher als Beethovens Töne, die in letzter Instanz ja auch nur Geräusche sind. Man muss es schärfer sagen: Mason steht dem Alltag nahe und Beethoven steht ihm nicht nahe. Beethovens Landschaft ist ein Konstrukt, auch insofern übrigens, als es eine Figur der literarischen Topik aufnimmt, den locus amoenus, und ihn an die Stelle der Wirklichkeit setzt. (Das Zusammensein der Landleute seiner Zeit war nicht lustig.) Man kann daher sagen, Beethoven komponiere seine Landschaft „idealistisch“, Mason „materialistisch“. Aber das bedeutet nicht, dass Mason den Alltag widerspiegelt, vielmehr hören wir etwas wie transzendierte Alltagsgeräusche.
Zwischen den Sternen heißt seine Komposition und wir lesen im Programmbuch, ihn habe der „überwältigende[.], existenzielle[.] Eindruck des Sternenhimmels“ inspiriert. Das ist eine raffinierte Perspektive, weil sich die „tonale“ Musik seit alters auf die Harmonie der Sphären zurückgeführt hat. Mason holt das in den Nahbereich, denkt bei Sternen an den großen Abstand zwischen Menschen. Sein Titel ist ein Rilke-Zitat: „Zwischen den Sternen, wie weit; und doch, um wievieles weiter, was man am Hiesigen lernt. / Einer zum Beispiel, ein Kind... und ein Nächster, ein Zweiter -, o wie unfasslich entfernt.“ In diesen Worten liegt die ganze Wende, die ich tastend zu erfassen versuche. Die ältere „tonal“-„atonale“ Musik vor dem letzten Einschnitt war aus Bausteinen zusammengesetzt, deren Beziehung zueinander sich an einer fernen Unendlichkeit orientiert hat, obwohl das im Hören verdeckt war. Masons Aufmerksamkeit gilt stattdessen einer nahen Unendlichkeit, dem Abstand zwischen Menschen, von denen einer den andern nie ganz verstehen kann, die aber doch zusammensein und zusammen wirken können. Beides wird in seiner Komposition demonstriert. Die Sterne stehen für irdisches Erleben. Mason hört „flirrende, ‚schemenhafte‘ Harmonien“ in seinem Stück, die für ihn „die Qualität einer Fata Morgana [haben], etwas wie das klangliche Äquivalent zu Hitzeflimmern“.
Da könnte man auch philosophische Äquivalente benennen. Sich am Nahen statt physikalisch Fernen zu orientieren, empfiehlt Bruno Latour als Schlüssel zur ökologischen Rettung (Das terrestrische Manifest, 2017), vor ihm hat es Hannah Arendt getan (Vita activa oder Vom tätigen Leben, 1958). Emmanuel Levinas hat gefordert, den unendlichen Abstand zum nahen Menschen zu respektieren, statt sich in der „Totalität“ der Ferne zu verlieren, die er mit dem Totalitären assoziiert (Totalität und Unendlichkeit, 1961). Ich breche hier ab, obwohl noch viel zu sagen wäre. Über Masons Stück wie über die anderen Kompositionen des Abends - von Chaya Czernowin, Johannes Maria Staud und Milica Djordjvić -, die denselben neuesten Einschnitt der Musikentwicklung repräsentieren. Es spielte das ensemble recherche. Das Konzert wurde live übertragen, ein zweites Mal ist es am 20. Februar, 21.04 Uhr im kulturradio vom rbb zu hören.
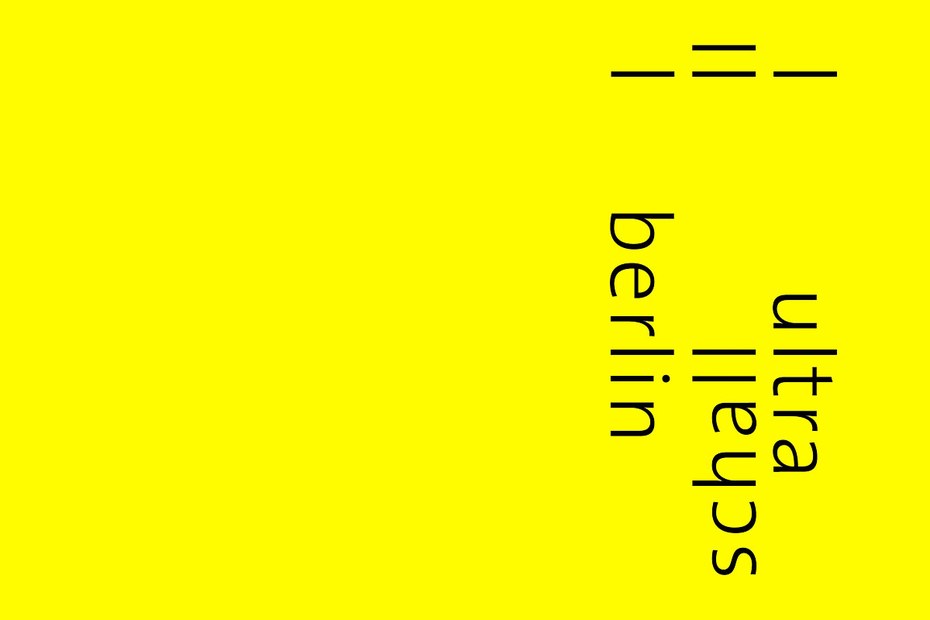





Was ist Ihre Meinung?
Kommentare einblendenDiskutieren Sie mit.